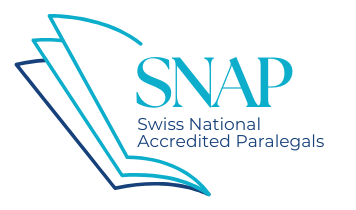Vorsorgeauftrag oder Generalvollmacht – was ist der Unterschied?
In ihrem Beitrag erklärt Fabienne Götschi-Grossert, Paralegal mit eidg. Fachausweis bei Hofstetter Advokatur und Notariat AG, was die beiden Dokumente unterscheidet, wann welches zum Einsatz kommt und worauf bei der Erstellung zu achten ist. Ein informativer Beitrag mit praktischem Nutzen - nicht nur für Paralegals.
Was ist ein Vorsorgeauftrag?
Ein Vorsorgeauftrag ist eine schriftliche Verfügung, in der eine Person bestimmt wird, die im Falle einer Urteilsunfähigkeit für die auftraggebende Person handelt. Das kann zum Beispiel bei Krankheit, Unfall oder im Alter der Fall sein. In einem Vorsorgeauftrag wird somit definiert, wer die persönlichen und finanziellen Angelegenheiten regeln soll, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Es wird unterschieden zwischen Personen- und Vermögenssorge. Weiter wird geregelt, dass die beauftrage Person die Vertretung im Rechtsverkehr übernimmt.
Personensorge: Der beauftragten Person kann das Recht eingeräumt werden, über alle für die Gesundheit notwendigen Massnahmen und Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere zur Sicherstellung der optimalen Behandlung, Betreuung und Pflege zu entscheiden. Die beauftragte Person soll die zu betreuende Person bei der Regelung ihres Alltags und nach Möglichkeit bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterstützen. Besteht eine Patientenverfügung, gehen diese Anordnungen (z.B. betreffend lebenserhaltende Massnahmen) dem Vorsorgeauftrag vor.
Vermögenssorge: Hier kann klar definiert werden, dass und wie die beauftragte Person die Wahrung der finanziellen Interessen der auftraggebenden Person und somit die Verwaltung des gesamten Vermögens, Verfügungen darüber und das Treffen sämtlicher damit zusammenhängender Massnahmen übernimmt. Darüber hinaus sollte möglichst wenig geregelt werden. Befinden sich jedoch Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien oder auch ein Fonds im Vermögen der auftraggebenden Person, sollte im Vorsorgeauftrag erwähnt werden, ob und inwiefern die beauftragte Person die bisher gewählte Anlagestrategie verändern darf. Der Grund hierfür ist, dass es ansonsten zu Problemen bei der Auslegung des Auftrages kommen kann. Weiter wichtig ist, dass geregelt wird, ob die beauftragte Person Vermögenswerte der auftraggebenden Person verschenken darf.
Rechtsverkehr: Darunter fallen das Veranlassen sämtlicher zur Erfüllung des Auftrags notwendiger Prozess- und Vertragshandlungen. Bei Grundstückgeschäften muss explizit erwähnt werden, dass der Erwerb, die Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und Veranlassung der entsprechenden Einschreibungen im Grundbuch erlaubt ist. Es wird davon abgeraten, einzelne Grundstücke aufzulisten. Auch hier gilt, je allgemeiner der Auftrag formuliert ist, desto weniger Probleme gibt es für die beauftragte Person bei der Umsetzung.
Wie bereits ausgeführt, wirkt der Vorsorgeauftrag erst bei Urteilsunfähigkeit der auftraggebenden Person. Sobald also eine Person urteilsunfähig ist, muss ein allenfalls vorhandener Vorsorgeauftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB eingereicht werden. Die KESB prüft dann unter anderem, ob der Vorsorgeauftrag gültig errichtet worden ist, die Urteilsfähigkeit durch eine Fachperson bestätigt wurde und die beauftragte Person für die Erfüllung des Auftrages geeignet ist. Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, wird der Vorsorgeauftrag validiert. Das heisst, ab dann ist er in Kraft gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt handelt die gewählte Person als Beistand / Beiständin im Namen der auftraggebenden Person. Der Zeitpunkt der Wirkung beginnt somit mit dem Entscheid der KESB über die Inkraftsetzung des Vorsorgeauftrags. Besteht kein Vorsorgeauftrag, ernennt die KESB einen Beistand.
Der Auftrag endet mit der Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit oder dem Tod der auftraggebenden Person.
Zur gültigen Errichtung eines Vorsorgeauftrages gibt es zwei Formen. Entweder muss er von Anfang bis Ende von Hand geschrieben und unterzeichnet oder notariell beurkundet werden.
Es empfiehlt sich, mehrere Personen alternativ zu beauftragen. Dies für den Fall, dass eine beauftragte Person selbst nicht mehr in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Vor der Erstellung des Vorsorgeauftrags sollen die zu beauftragenden Personen angefragt werden, ob sie bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Beim Zivilstandsamt kann eingetragen werden, dass ein Vorsorgeauftrag besteht. Auch kann ein Vermerk zum Hinterlegungsort (z.B. Büro, roter Ordner) gemacht werden.
Was ist eine Generalvollmacht?
Eine Generalvollmacht ist eine umfassende Vollmacht, die einer Person erteilt wird, um im Namen der vollmachtgebenden Person zu handeln. Umfassend bedeutet, dass die bevollmächtigte Person die vollmachtgebende Person nach Bedarf in allen rechtlichen, finanziellen und persönlichen Angelegenheiten vertreten kann. Ausgenommen sind in der Regel Grundstückgeschäfte, diese müssen wie beim Vorsorgeauftrag explizit erwähnt werden. Wichtig zu wissen ist, dass Banken eine Generalvollmacht oft nicht akzeptieren, sie verlangen die Unterzeichnung der eigenen, standardisierten Vollmachten. Eine Vertretung kann nötig werden, wenn sich die vollmachtgebende und urteilsfähige Person im Ausland oder Spital befindet, unter Zeitmangel leidet, die Angelegenheit besonders komplex ist etc.
Entgegen der Meinung vieler, empfiehlt sich eine Generalvollmacht auch für Ehepaare. Versicherungen, Krankenkassen oder Ärzte können sich z.B. auf die Schweigepflicht berufen, Ehepartner erhalten deshalb ohne Generalvollmacht nur eingeschränkt Auskünfte. Aber auch wenn die gemeinsame Steuererklärung dringendst eingereicht werden muss, weil die letzte Fristerstreckung abläuft und ein Ehepartner gerade im Urlaub ist, kann eine Generalvollmacht zur Anwendung gelangen.
Sobald die auftraggebende Person jedoch urteilsunfähig ist, wird der Vorsorgeauftrag validiert und die Generalvollmacht erlischt.
Eine Generalvollmacht kann formfrei erstellt werden, jedoch empfiehlt es sich, die Unterschrift der auftraggebenden Person notariell beglaubigen zu lassen.
Was geschieht im Todesfall?
Beide Dokumente verlieren in der Regel mit dem Tod der auftraggebenden Person respektive der vollmachtgebenden Person ihre Gültigkeit. Im Vorsorgeauftrag kann jedoch bestimmt werden, dass er nach dem Versterben der auftraggebenden Person als Vollmacht über den Tod hinaus weiterbestehen soll, sofern diese nicht letztwillig einen Willensvollstrecker / eine Willensvollstreckerin eingesetzt hat. In diesem Fall fällt natürlich der Auftrag zur Personensorge dahin und lediglich der Auftrag zur Vermögenssorge und zur Vertretung im Rechtsverkehr bleibt bestehen. Die Generalvollmacht kann, wenn dies ausdrücklich darin bestimmt wird, auch über den Tod hinaus zur Überbrückung bis zur Ausstellung des Erbenscheines gelten, sofern dies für das entsprechende Rechtsgeschäft zulässig ist. Nach dem Versterben der auftrag- bzw. vollmachtgebenden Person sind Rechtshandlungen oder auch Zahlungen nur äusserst zurückhaltend vorzunehmen. Insbesondere wenn die beauftragte respektive bevollmächtigte Person zugleich Erbe / Erbin der verstorbenen Person ist, besteht die Gefahr, dass Handlungen im Nachlass als sogenannte Einmischung gelten, wodurch das Erbe ohne weiteres angenommen wird. Sollen Vorsorgeaufträge und Generalvollmachten nach dem Tod weiter verwendet werden, empfiehlt es sich Rücksprache mit einer Fachperson zu nehmen, um allfällige Fallstricke frühzeitig zu erkennen.
Es empfiehlt sich eine Beratung bei einer Fachperson, damit die Dokumente den persönlichen Bedürfnissen entsprechen.