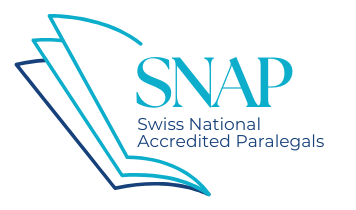Das Arbeitsgericht Genf im Fokus – Einblicke in das “Tribunal des prud’hommes”
Seit 25 Jahren als Paralegal in der juristischen Abteilung einer multinationalen Gesellschaft in Genf tätig, spezialisierte sich Daniel Bundy über die Jahre vor allem auf das Schweizer Gesellschaftsrecht und seit einigen Jahren auch auf das Schweizer Arbeitsrecht. In letzterem Fachgebiet arbeitet er eng mit der internen Personalabteilung zusammen und unterstützt sie in herausfordernden Situationen, von möglichen Kündigungen, über Disziplinarverfahren bis zu rechtlichen Auseinandersetzungen vor Gericht.
Im Kanton Genf gibt es eine Besonderheit, die Daniel in seiner täglichen Arbeit immer wieder erlebt: Die erste Instanz des Genfer Arbeitsgerichtes (Tribunal des prud’hommes de Genève – “TPH”) besteht aus Laienrichtern. Dies ist in der Schweiz nicht die Regel, und macht das TPH speziell. Die Entscheidungen werden von Richtern getroffen, die tief in der Arbeitswelt verwurzelt sind, was seiner Meinung nach zu sehr praxisorientierten Urteilen führt.
Für einen tieferen Einblick in die Materie gibt uns Daniel eine detaillierte Übersicht über das Verfahren bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten im Kanton Genf[1].
Zuständigkeiten des Tribunal des prud’hommes
Materielle Zuständigkeit: Das TPH entscheidet über Streitigkeiten, die aus einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag resultieren, unabhängig von der Höhe des Streitwerts. Streitigkeiten zwischen Beamten der öffentlichen Verwaltung und dieser werden nicht vom TPH, sondern von der Verwaltungskammer des Gerichtshofes (Cour de justice - chambre administratif) entschieden. Das Arbeitsgericht ist auch nicht zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit kantonalen oder eidgenössischen Sozialversicherungen.
Örtliche Zuständigkeit (Gerichtsstand): Der Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder der Ort, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, bestimmen den Ort, an dem die Klage eingereicht werden muss[2].
Kollektive Streitigkeiten: Die Kammer für kollektive Arbeitsbeziehungen in Genf ist zuständig, um soweit wie möglich kollektive Streitigkeiten über Arbeitsbedingungen zu verhindern und zu schlichten, einschliesslich der Anwendung des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995[3]. Sie behandelt auch alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung oder Auslegung eines Gesamtarbeitsvertrags und entscheidet als öffentliches Schiedsgericht über alle Streitigkeiten, die ihr im Einvernehmen der Parteien vorgelegt werden. Ein Streit wird als kollektiv betrachtet, wenn 6 Arbeitnehmer rechtliche Schritte einleiten.
Organisation des TPH
Das TPH ist wie folgt unterteilt:
Die Schlichtungsbehörde, geleitet von einem[4] Schlichtungsrichter mit juristischer Ausbildung.
Das Gericht, das aus einem Präsidenten, einem Arbeitgeberrichter und einem Arbeitnehmerrichter besteht (Laienrichter).
Organisation des Gerichts
Das Gericht setzt sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrichtern zusammen, die aus verschiedenen Berufsgruppen stammen.
Es handelt sich um Laienrichter, juristische Kenntnisse sind keine Voraussetzung, um als Beisitzer amten zu können. Um das Amt des Präsidenten ausüben zu können, bedarf es allerdings eines Fähigkeitsausweises. Die Justizbehörde organisiert in der Regel einmal pro Legislaturperiode die Ausbildung der Arbeitsrichter und der Kandidaten für das Präsidentenamt, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Rechtsfakultät der Universität Genf und den Sozialpartnern.[5]
Die Richter sind in 4 Gruppen nach Tätigkeitsbereich unterteilt:
Landwirtschaft und Landschaftsbau; Hausmeisterdienste und Reinigung; Bauwesen und Baustoffe (Hochbau, Tiefbau, öffentliche Arbeiten, Bau- und Metallurgie, alle anderen Berufe im Bauwesen, einschliesslich Schornsteinfeger und Baumaschinen); Architektur und Ingenieurwesen; nicht-lebensmittelverarbeitende Industrie (Uhrenindustrie, Schmuck- und Goldschmiedekunst); Metallindustrie: Mechanik, Präzisionsmechanik, Garagen und Karosseriebau mit Ausnahme des Verkaufs; Elektronik; optische Instrumente; Bekleidung und Leder; Druckerei und Verlagswesen.
Gastgewerbe, Cafés und Restaurants; Handwerk und Lebensmittelindustrie; Handel und Distribution; Grosshandel; Transport und Reisen; Friseur- und Schönheitsdienstleistungen.
Banken, Versicherungen und Dienstleistungsunternehmen; Finanz- und Sicherheitsgesellschaften; Immobilienverwaltung und Immobilienvermittlung; Einrichtungen oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, sofern ihre Tätigkeit nicht in eine andere Gruppe fällt.
Verschiedene Berufe, die nicht in den anderen Gruppen enthalten sind, insbesondere: medizinische und paramedizinische Einrichtungen und Berufe; Drogerie- und Pharmaindustrie; juristische Berufe; Vermittler; künstlerische Berufe; Unterricht und Ausbildung; Presse und andere Medien; Informatik; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit; Haushaltsökonomie und häusliche Hilfen.
Das Arbeitsgerichtsverfahren
Die Einreichung des Antrags
Der Antrag, welcher beim Sekretariat des Arbeitsgerichts eingereicht werden muss, muss die Parteien vollständig benennen (Namen und Vornamen oder Firmenname, gültige Adresse usw.). Die Klage muss klar darlegen, welche Summe gefordert wird und was der Gegenstand des Streits ist (wenn der Streitwert nicht über CHF 30'000.- liegt). Übersteigt dieser Wert CHF 30'000.-, muss der Antrag eine vollständige Darstellung der Fakten enthalten, wobei für jeden Fakt auf die Beweismittel verwiesen werden muss.
Alle relevanten und nützlichen Unterlagen müssen beigefügt sein, wie beispielsweise:
Arbeitsvertrag
Kündigungsschreiben
Lohnabrechnungen
Das Schlichtungsverfahren
Nach Einreichung des Antrags auf Schlichtung werden die Parteien zu einem Schlichtungsversuch eingeladen, der innerhalb von 2 Monaten stattfindet.
Die Parteien müssen persönlich erscheinen; sie können von einer nahestehenden Person, einem Anwalt oder einem anderen professionell qualifizierten Vertreter (z.B. einem Gewerkschaftssekretär) begleitet werden.
In bestimmten Fällen (z.B. Krankheit, Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland) kann eine Partei durch eine nahestehende Person, einen Anwalt oder einen anderen professionell qualifizierten Vertreter bei der Anhörung vertreten werden. Es ist jedoch unerlässlich, dies vor der Anhörung zu beantragen und die gegnerische Partei darüber zu informieren.
Ein Unternehmen kann durch einen vertretungsbefugten Mitarbeiter vertreten werden.
Ein Protokoll wird erstellt und wird von den Parteien und dem Schlichtungsrichter unterzeichnet. Wird eine Einigung erzielt, wird diese im Protokoll festgehalten, das den Wert eines Urteils hat, und eine Kopie wird den Parteien übergeben. Wenn keine Einigung erzielt wird, erhält der Antragsteller eine Genehmigung zur Fortsetzung des Verfahrens.
In bestimmten Fällen kann die Schlichtungsbehörde einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten, wenn die Schlichtung nicht erfolgreich ist. Sie teilt diesen Vorschlag den Parteien mit, und jede Partei kann – durch eine schriftliche und unbegründete Erklärung – Widerspruch gegen den Entscheidungsvorschlag einlegen. Wenn innerhalb von 20 Tagen keine Partei Widerspruch gegen den Vorschlag einlegt, wird dieser rechtskräftig.
Wenn jedoch eine Partei Widerspruch einlegt und dem Entscheidungsvorschlag widerspricht, erteilt die Schlichtungsbehörde dem Antragsteller eine Genehmigung zur Fortsetzung des Verfahrens.
Der Schlichtungsrichter kann auf Antrag des Antragstellers auch eine Entscheidung treffen, sofern der Streitwert 2'000 Franken nicht übersteigt.
Die Verfahrensbewilligung ermöglicht es dem Antragsteller, die Angelegenheit innerhalb einer Frist von drei Monaten vor Gericht zu bringen.
Das Gerichtsverfahren
Nach Erhalt des Antrags und der Genehmigung zur Fortsetzung des Verfahrens sowie der Unterlagen übermittelt das Gericht ein Exemplar an den Beklagten und setzt ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme zum Antrag.
Das Gericht lädt dann die Parteien zu einer Verhandlung zur Beweisaufnahme (débat d’instruction) ein (für ordentliche Verfahren mit einem Streitwert über CHF 30'000.-). Nach dieser Verhandlung eröffnet das Gericht das Beweisverfahren (administration des preuves). Das Beweisverfahren kann insbesondere die Anhörung von Zeugen umfassen.
Nach Abschluss des Beweisverfahrens haben die Parteien die Möglichkeit zu plädieren. Das Gericht behält dann den Fall zur Entscheidung. Schliesslich wird das Urteil des Gerichts erlassen und den Parteien mitgeteilt.
N.B.: Wenn der Streitwert unter CHF 30'000.- liegt, ist das Verfahren vereinfacht. Das Gericht kann manchmal nur eine einzige Anhörung durchführen, die formellen Anforderungen sind geringer und das Gericht stellt die Tatsachen von Amts wegen fest.
[1] Quelle: https://justice.ge.ch/media/2023-12/brochure-litige-employe-employeur.pdf
[2] Art. 34 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) – SR 272
[3] Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) - SR 151.1
[4] Wenn eine Klage auf dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann basiert, setzt sich die Schlichtungsbehörde sus einem Schlichtungsrichter oder einer Schlichtungsrichterin, die den Vorsitz führt, und zwei Schlichtungsrichtern als Beisitzern, einem Mann und einer Frau, zusammen. Ist der Mann Arbeitgeber, muss die Frau Arbeitnehmerin sein und umgekehrt.
[5] Art. 1 Règlement sur la formation des juges et présidents du Tribunal des prud’hommes – E 3 10.03